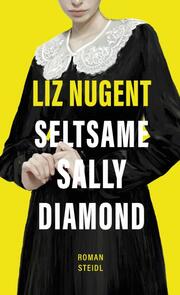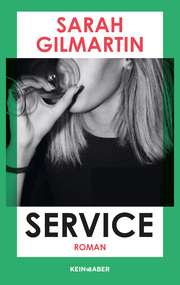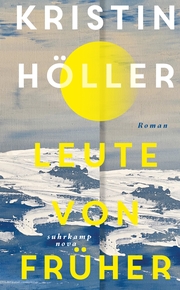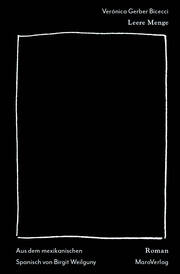Rafaels Tipp

Rosa Schleim
Orientierungslose Fürsorge in einer verwelkenden Welt. Sie wandelt durch die Stadt, mit der giftigen Luft, mit dem giftigen Fluss, mit dem giftigen Stuss, den sie im Fernsehen erzählen. Sie kümmert sich um den Ex-Mann mit der Krankheit, an der eigentlich die meisten Menschen sterben, ihre Mutter, die nicht ertragen kann, dass es nur noch rosa Fleischpaste zu essen gibt und dem Kind, das niemals satt wird, egal wie viel es isst.
Sie sagt, dass sie spart um zu verschwinden aus dem Ort wo sie aufgewachsen ist, an den sie sich noch erinnert bevor die Fische tot an den Strand gespült wurden und der rote Wind angefangen hat alles, was er streift, zu vernichten, dabei hat sie das Geld schon längst zusammen. Was hält sie also noch und wird es jemals wieder besser werden? Fernanda Trías konstruiert eine hellsichtige, realistische Dystopie, die aber ebenso von zarter Schönheit und durchdringender Sprache geprägt ist. Fertiggestellt ein Jahr vor der Pandemie liest sich der Text fast prophetisch und wird auf keinen Fall an Aktualität verlieren, in Zeiten sich überlagernder ökologischer Krisen und des Klimawandels. Ich habe den Roman mit einer Mischung aus Angst, Sorge und Neugier gelesen, die ich sonst selten erfahre und die mich auf eigentümliche Weise elektrisiert hat.